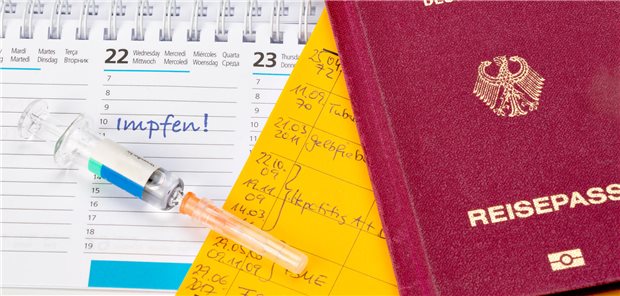Diskussion auf Medica
Bessere Datenvernetzung für die Spitzenmedizin
Wie lässt sich Spitzenmedizin für alle Patienten zugänglich machen? Dies diskutierten Experten auf der Medica. Wichtig wäre als erster Schritt, Patientendaten für alle zugänglich zu machen.
Veröffentlicht:
Die Idee: Werden Versorgungsdaten zusammengeführt, lassen sich auch Innovationen mit echtem Mehrwert für Patienten schneller herausfiltern und in die Fläche tragen.
© Torbz / fotolia.com
DÜSSELDORF. Viele Innovationen in der Medizin kommen bislang nicht bei den Patienten an, weil die Systematik fehlerhaft ist, monierten Experten bei einer Diskussionsrunde auf dem Medica Econ Forum der Techniker Krankenkasse.
"Es läuft vieles, aber wir haben wenig Lerneffekte, weil wir kaum evaluieren", kritisierte Professor Volker Ulrich, Gesundheitsökonom an der Universität Bayreuth. Versorgungsforschung sei noch immer ein weißer Fleck in Deutschland.
"Spitzenmedizin für alle Patienten - Gestaltungselemente für die Krankenkassen" mit dieser These beschäftigte sich die Diskussionsrunde.
Ihr Fazit: Innovationen, die tatsächlich einen Mehrwert für Patienten bringen, müssen diesen auch zugute kommen, und neue Produkte oder Methoden, die ihren Nutzen bewiesen haben, lassen sich auch finanzieren. Daneben hat das Thema aber auch viele Aspekte, die nichts mit Geld zu tun haben.
Vieles wäre schon gewonnen, wenn die Versorgungsdaten, die an den verschiedensten Stellen vorliegen, endlich zugänglich gemacht und zusammengeführt würden, sagte Dr. Bernhard Rochell, Hauptgeschäftsführer der Bundesärztekammer.
Das müsse vor allem sektorübergreifend geschehen. "Da muss man gar keine großen Mittel reinstecken."
Die Kassen sind in der Pflicht
Professor Michael Albrecht sieht die Krankenkassen in der Pflicht: "Sie haben die Daten in ihrem Keller", sagte der Vorsitzende des Verbands der Universitätsklinika Deutschlands. Die Frage sei nur, wie groß tatsächlich das Interesse an einer Auswertung sei.
"Ich habe nichts dagegen, die Daten zur Verfügung zu stellen", konterte Thomas Ballast, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse. Er gab aber auch zu: "Wir haben keine Fehlerkultur, das Problem wird immer beim anderen gesucht."
"Die größte Innovation ist es, die Patienten wieder mit einzubeziehen", meinte Professor Edmund Neugebauer von der Universität Witten-Herdecke, derzeit Vorsitzender des deutschen Netzwerks für Versorgungsforschung.
Besonders auf die individuellen Anforderungen und Erwartungen jedes Patienten müsse mehr Rücksicht genommen werden. "Die Ressource Patient hat man noch nicht gehoben. Warum fragt man ihn nicht, was er einbringen kann?"
Nötig ist dazu allerdings eine bessere Aufklärung der Patienten. Mit den neuen digitalen Informationsmöglichkeiten käme das aber ganz von alleine. "Häufig sind doch chronisch kranke Patienten besser gebildet als der junge Doktor", sagte Neugebauer.
Für die Mediziner wird damit die Kommunikationsfähigkeit immer wichtiger. "Das fängt bei der Auswahl der Studierenden an", sagte Rochell von der Bundesärztekammer. Nicht unbedingt sei der beste Abiturient auch derjenige mit einer großen Zuwendungsfähigkeit.
Politik gibt zu wenig Impulse
Von den Koalitionsverhandlungen in Berlin hatten sich alle Teilnehmer der Diskussionsrunde mehr Impulse für das Thema erhofft.
Rochell lobte immerhin, dass sich die Regierung des Themas annehmen wolle, wenn die Details - wie die Einrichtung eines neuen Instituts und die Zuständigkeiten des gemeinsamen Bundesausschusses - auch noch weiter diskutiert werden sollten.
Ballast dagegen konstatierte: "Der Zug ist abgefahren." Das sei allerdings auch nicht allzu tragisch, da der Koalitionsvertrag nur einen groben Rahmen vorgebe, der sich immer noch mit konkreten Vorhaben füllen ließe.